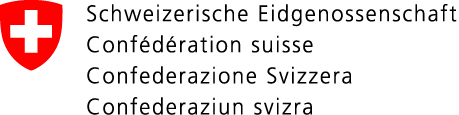Intervista, 27 maggio 2023: Aargauer Zeitung; Doris Kleck, Othmar von Matt
(Questo contenuto non è disponibile in italiano.)
Google und Co. sollen künftig die Schweizer Medien für ihre Inhalte entschädigen, sagt Elisabeth Baume-Schneider. Und die Justizministerin wird deutlich, wenn es um den "Fall Stäfa" geht.
Fast fünf Monate ist es her, seit Elisabeth Baume-Schneider ihr Büro im Bundeshaus West bezogen hat. Die Möbel sind ausgewählt, aber noch nicht geliefert. Auch bei Lieferfristen haben Regierungsmitglieder keine Vorteile in diesem Land. Die Wände sind noch kahl. Bilder wird die Jurassierin erst auswählen, wenn die Möbel da sind.
Dafür stechen die vielen, bunten Blumen ins Auge. Den Schwarznasenschafen gehe es gut, antwortet sie auf die obligate Frage – und fügt an: Nein, diese Frage nerve sie nicht. Die Schafe gehörten zu ihr, der Bauerntochter. Aber sie macht klar, dass sie nicht auf die Schwarznasenschafe reduziert werden will.
Frau Bundesrätin, suchen Sie News auf Google?
Elisabeth Baume-Schneider: Das kommt vor, ja. Für mich ist die Qualität der Nachrichten entscheidend. Die Informationen müssen richtig und nützlich sein.
Sie sind auf Twitter und auf Facebook.
Ja, aber nicht sehr aktiv. Und auf Instagram bin ich noch gar nicht. Ich bin keine Künstlerin der sozialen Medien. Mir ist neben der Qualität der Informationen auch die Herkunft einer Nachricht zentral. Deshalb ist das Gesetz zum Leistungsschutzrecht auch derart wichtig. Wir haben es diese Woche in die Vernehmlassung geschickt. Mir geht es darum, dass jene richtig bezahlt werden, welche die Informationen erarbeiten. Deshalb brauchen wir eine gerechte Entschädigung der Medieninhalte.
Sie haben den Tech-Giganten den Kampf angesagt, Google & Co. sollen den Schweizer Verlagen Millionen bezahlen. Was läuft heute falsch?
Die grossen Plattformen sind der Ort, wo wir nach Informationen suchen. Wir müssen ein neues Gleichgewicht schaffen zwischen den Tech-Giganten und den Verlagen. Tun wir das nicht, ist die Qualität der Informationen nicht mehr garantiert. Das wäre ein Problem für die Demokratie.
Vordergründig geht es beim Leistungsschutzrecht um das Urheberrecht. Aber eigentlich geht es um mehr – um die Demokratie?
Ja! Information ist die DNA der Demokratie. Das hat der Abstimmungskampf um das Mediengesetz gezeigt. Informationen müssen nicht nur von hoher Qualität sein, sie müssen auch in allen Regionen verfügbar sein. Es darf nicht sein, dass es nur noch grosse Technologiekonzerne und grosse Medienhäuser gibt – und die kleinen aussterben.
Es sind vor allem die grossen Medienhäuser, die das Leistungsschutzrecht fordern. Wie stellen Sie sicher, dass auch die kleinen Medienhäuser profitieren?
Anders als in der EU ist das Leistungsschutzrecht bei uns so ausgestaltet, dass alle Medienhäuser von der Vergütung der Snippets – also der Textausschnitte– durch Google & Co. profitieren. Dank der kollektiven Verwertung profitieren auch die kleinen Verlage. Die Vergütung der Tech-Firmen wird aber leider nicht reichen, um die strukturellen Probleme der Schweizer Medien zu lösen.
Wie viel Geld wird das Leistungsschutzrecht den Verlagen bringen?
Das kann man heute noch nicht sagen. Aber es gibt eine Studie des Verbandes Schweizer Medien. Darin wird ein Anspruch auf 154 Millionen Franken geschätzt.
Das ist doch keine realistische Schätzung.
Das weiss ich nicht. Andere sagen, es gebe gar kein Geld für die Verlage. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Es ist aber tatsächlich schwer vorstellbar, dass dereinst 154 Millionen Franken unter den Medienhäusern verteilt werden können.
Die Gegner sprechen von einer Linksteuer. Teilen und Verlinken gehöre zum Wesen des Internets. Wollen Sie die Freiheit des Internets beschneiden?
Nein. Unser Gesetzesvorschlag ist – im Gegensatz zur Regulierung der EU –nicht auf Verbote ausgerichtet. In Deutschland können Verlage Google die Verbreitung von Snippets verbieten. Bei uns ist die Informations-und Meinungsfreiheit gewährleistet. Es gibt keine Polizei, die bestimmt, welche Informationen auf den Plattformen geteilt werden dürfen. Ausserdem: Für die Verbreitung von Links ohne Text ist keine Vergütung vorgesehen.
Gleichzeitig sind die Medienhäuser auf die Techgiganten angewiesen. Sie teilen Artikel via Twitter oder Facebook. Ohne Internetgiganten keine Reichweite.
Sie haben recht, das ist eine paradoxe Situation. Die Medien brauchen die Internetgiganten – und umgekehrt. Doch das System funktioniert eben nicht mehr, wenn der kleine Medienanbieter verschwindet, weil ihm die Ressourcen fehlen. Dann fehlen Google auch qualitativ gute Informationen.
Ein Thema, das die Medienhäuser stark beschäftigt, ist der Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI). Auch Chatbots stützen sich auf journalistische Informationen. Weshalb bezieht der vorgesehene Gesetzestext KI nicht ein?
Wir stellen in der Vernehmlassung Fragen zur Regulierung der künstlichen Intelligenz. Für mich ist klar: Wir müssen dies aufnehmen. Wir können nicht das Urheberrecht reformieren, ohne die KI zu berücksichtigen. Sie ist in der Gesellschaft angekommen. Mir ist aber noch nicht klar, wie wir das rechtlich tun können. Übrigens machen ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten Chatbots besser.
Sondern?
Alle Menschen, die sich im Internet bewegen. So gesehen, bin auch ich eine Art Mitarbeiterin dieses Unternehmens.
Sie nutzen Chatbots wie ChatGPT?
Klar, habe ich das ausprobiert. Ich bin ein neugieriger Mensch und will wissen, wovon ich rede.
Was haben Sie gefragt?
(lacht) Wer ist Elisabeth Baume-Schneider?
Was war die Antwort?
Dass ich eine Politikerin bin. Aber jünger als in der Realität.
ChatGPT wusste nicht, dass Sie Bundesrätin sind?
(lacht) Nein.
Fast schon beruhigend, sonst hätte ChatGPT hellseherische Fähigkeiten. Sein Kenntnisstand beruht auf September 2021. Da waren Sie noch nicht gewählt. Zu einem anderen Thema. Sie sind auch Gesellschaftsministerin.
Ja, mein Departement ist unglaublich vielseitig. Die Migrationsfrage steht stark im Fokus der Öffentlichkeit. Andere Themen, bei denen ich viel bewirken kann, werden weniger wahrgenommen.
In der Deutschschweiz lassen Genderfragen die Wogen hochgehen. In der Romandie auch?
Genderdiskussionen werden in der Westschweiz weniger emotional geführt als in der Deutschschweiz. Sie sind weniger verpolitisiert. Ich war vor meiner Wahl in den Bundesrat Direktorin einer Fachhochschule. Dort erlebte ich Diskussionen zu Sexualität und Geschlecht als Auslöser von viel positiver Dynamik, von Vielfalt, Kreativität und Respekt. So kommt unsere Gesellschaft voran.
In der Deutschschweiz sieht das anders aus. Die Zürcher Gemeinde Stäfa musste wegen Drohungen einen "Gender-Tag" an der Schule absagen. Was sagen Sie dazu?
Unsere Demokratie beruht auf Respekt gegenüber Minderheiten und gegenseitigem Verständnis. Die "Ehe für alle" war ein starkes Signal, dass sich die Gesellschaft weiterentwickeln möchte. Die Ereignisse in Stäfa deuten in eine andere Richtung, und das bedaure ich. Ich verstehe nicht, dass man Schulen vorschreiben will, nur ein bestimmtes traditionelles Geschlechtermodell zu verbreiten. Im Lehrplan 21 steht klar, dass das Kennenlernen der eigenen Sexualität, dazu zählt auch die sexuelle Identität, wichtig ist. Die Tonalität im Fall Stäfa macht mich traurig.
Ist dieser Respekt in Gefahr? Im Fall von Stäfa kam es zu Morddrohungen.
Ja, es ist traurig und gefährlich, wenn die Grundsätze unseres Zusammenlebens infrage gestellt werden. Es geht nicht einfach um den Gendertag oder um Links oder Rechts. Es geht um die Fähigkeit, mit anderen Meinungen umzugehen und sie zu akzeptieren. Wir müssen sehr aufmerksam sein und auf solche Exzesse reagieren.
Man hat den Eindruck, die SVP habe den Kulturkampf aus den USA kopiert.
In den USA und auch anderswo sind die Demokratien destabilisiert, der Minderheitenschutz ist in Gefahr. Deshalb ist eine stabile Demokratie wichtig. Sie verhindert Exzesse. Mich interessiert nicht, wer diese Fragen aufbringt, sondern wie die Gesellschaft darauf reagiert.
Die Polarisierung und damit die Bedrohung von Politikern hat stark zugenommen. Spüren Sie dies als Bundesrätin?
Ich persönlich nicht. Aber die Gräben gehen sehr schnell auf und werden auch schnell sehr tief. Das war bei der Covid-Impfung so und ist es heute beim Thema Neutralität. Aber wir müssen klar unterscheiden, wo die Meinungsfreiheit aufhört und wo Hass und Diskriminierung beginnen.
SVP-Nationalrat Andreas Glarner veröffentlichte im Fall Stäfa die Telefonnummer einer Lehrerin. Das ist rechtlich zulässig. Muss da etwas geschehen?
Die Bundesverwaltung prüft derzeit die Frage, wie man rechtlich auf Gewalt im Internet reagieren kann – unabhängig vom Fall Stäfa. Auch das sogenannte Doxing wird angeschaut, also das Veröffentlichen privater Informationen mit bösen Absichten. In meiner Zeit als Bildungsdirektorin im Kanton Jura habe ich ähnliche Fälle erlebt. Die Sache ist kompliziert. Leute, die solche Nummern weiterverbreiten, weisen darauf hin, dass diese ohnehin auf der Internetseite der Schule zu finden seien.
Emotional ist auch die Migrationsdebatte. Italien nimmt keine Asylbewerber mehr zurück, für die es gemäss Dublin zuständig wäre. Damit wackelt ein Pfeiler des europäischen Asylsystems. Nächste Woche treffen Sie Ihren italienischen Amtskollegen. Was können Sie bewirken?
Ich erwarte keine Wunder. Ich werde mich davor hüten, Matteo Piantedosi eine Moralpredigt zu halten. Die Situation in Süditalien ist wirklich schwierig. Dennoch ist es wichtig, zu sagen: Wir erwarten, dass Italien die Regeln von Schengen/Dublin respektiert und die Asylsuchenden zurücknimmt, für die das Land zuständig ist. Ich werde mit dem Minister aber auch Projekte im Migrationsbereich diskutieren. Die Schweiz hat Geld dafür im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags an die EU im Migrationsbereich budgetiert.
Das ist sehr schweizerisch: Sie reisen mit einem Koffer voll Geld nach Rom und hoffen, dass Italien einlenken wird.
Italien wartet nicht auf Geld aus der Schweiz. Der Rücknahmestopp hat innenpolitische Gründe. Mir geht es darum, die Situation zu verbessern und mit meinem Amtskollegen eine gute, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.
Vor der Bundesratswahl haben Sie betont, dass Sie eine humanitäre Flüchtlingspolitik machen wollen. Linke Kreise sind nun enttäuscht. Waren Sie naiv?
Nein, mit meinen sechzig Jahren bin ich das nicht mehr. Ich mache auch keine Versprechen. Meine Politik soll aber meinen Werten entsprechen und humanitär sein. Allerdings wusste ich schon vor meiner Wahl, dass ich die Migrationspolitik nicht alleine gestalte. Ich mache sie mit der EU, dem Bundesrat, dem Parlament und mit der Bevölkerung. Wir müssen aber alles tun, um die Würde der Menschen und den Rechtsstaat zu respektieren. Dafür engagiere ich mich.
Zum Beispiel?
Wichtig ist für mich, die Situation der minderjährigen, unbegleiteten Asylsuchenden zu verbessern. Die Zahlen steigen. Wir müssen wirklich eine Diskussion über Bildungsprojekte und Integration führen, sonst bekommen wir ein Problem. Humanitär heisst für mich aber nicht, dass ich Amnestien für Flüchtlinge unterzeichne.
Sondern?
Dass ich das Asylsystem ihm Rahmen meiner Verantwortung würdig gestalte. Nehmen Sie die Resettlement-Flüchtlinge. Man hat gesagt, ich sei naiv, weil ich dieses Programm für die besonders schutzbedürftigen Personen wieder aufnehmen wollte. Damit bin ich bei den Kantonen aufgelaufen. Es ist richtig: Ich möchte wieder Resettlement-Flüchtlinge in die Schweiz holen. Um das zu erreichen, muss ich mit den Kantonen zusammenarbeiten.
Gibt es hier Bewegung?
Derzeit nicht. In der Asylpolitik hat aber alles einen Zusammenhang. Nächste Woche entscheidet das Parlament über Kredite für temporäre Unterkünfte für Flüchtlinge. Mit diesen zusätzlichen Betten bereitet sich der Bund für den Herbst vor, damit er Asylsuchende nicht wieder früher als vorgesehen den Kantonen zuweisen muss. Das ist wichtig für die gute Zusammenarbeit mit den Kantonen. Werden die Kantone nicht zusätzlich belastet, sind sie vielleicht eher bereit, wieder 80 oder 100 der verletzlichsten Flüchtlinge aufzunehmen.
Sind Sie enttäuscht, dass Sie nicht durchsetzen können, was Sie unbedingt möchten?
Nein. All meine Energie fliesst dahin, dass meine Werte nicht blosse Worte bleiben. Enttäuschung gibt keine Energie. Ich frage mich aber jeden Tag, was ich besser machen könnte. Ja, ich bin unzufrieden mit der Sistierung des Resettlement-Programms. Aber ich kann nicht einfach einsame Entscheide fällen, aus meinem Büro heraus.
Sie könnten Ihren Spielraum besser nutzen, sagt die Linke. Etwa bei der Rückführung von kroatischen Asylsuchenden, die dort nachweislich schlecht behandelt werden. Die Schweiz könnte die Souveränitätsklausel anwenden und entscheiden, die Verfahren selbst durchzuführen.
Bei Kroatien muss man differenzieren. Es gab Pushbacks an den Aussengrenzen, das ist inakzeptabel. Bei der Betreuung von Dublin-Asylsuchenden im Landesinnern hingegen haben wir keine Hinweise auf Misshandlungen. Aber Sie haben recht, man kann die Rückführungen unterschiedlich bewerten. Sie wissen aber auch: Solche Entscheide kündigt man nicht in einem Medium an.
Info complementari
Medienmitteilungen
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Ultima modifica 27.05.2023